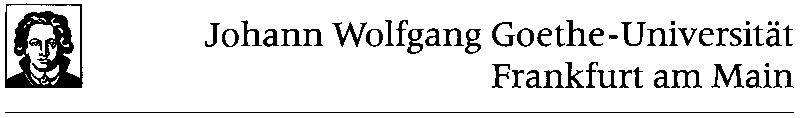
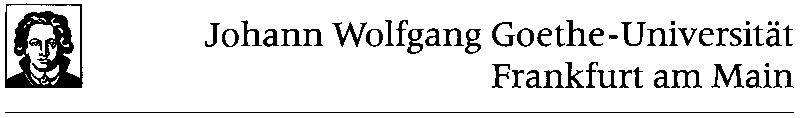
Fachbereich Ost- und Außereuropäische Sprach- und
Kulturwissenschaften
INSTITUT FÜR AFRIKANISCHE SPRACHWISSENSCHAFTEN
Vorbesprechung: 3.4.2000, 10 Uhr s.t., Kettenhofweg 135,
Bibliothek
K Swahili II (GS)
Beck, Rose Marie
Mi 12-14 (Vb 12.4.)
Weiterführung des im WS 1999/2000 begonnenen Sprachkurses Swahili
I.
K Swahili IV (GS)
Beck, Rose Marie
Mi 9-11 (Vb 12.4.)
Die Veranstaltung schließt den seit dem WS 1998/99 laufenden,
viersemestrigen Sprachkurs ab.
Ü Swahili-Konversation (GS)
Beck, Rosemarie
Mi 11-12 (Vb 12.4.)
Übungen und Konversation in Swahili, der wichtigsten Verkehrssprache Ostafrikas, begleitend zum Sprachkurs Swahili IV.
K Hausa IV (GS)
Ahmed, Yahaya
Fr 9-11 (14.4.)
Die Veranstaltung schließt den seit dem WS 1998/99 laufenden,
viersemestrigen Sprachkurs ab.
Ü Hausa-Konversation (GS)
Ahmed, Yahaya
Fr 11-13 (Vb 14.4.)
Übungen und Konversation in Hausa, der wichtigsten Verkehrssprache Nordnigerias, begleitend zum Sprachkurs Hausa IV.
P Morphologie und Syntax afrikanischer Sprachen (GS)
Storch, Anne
Mo 10-12 (Vb 10.4.)
Die Veranstaltung führt in die Grundlagen der Morphologie und
Syntax ein. Diskutiert werden die Abgrenzung Morphologie-Syntax
sowie Methoden der Beschreibung anhand ausgewählter afrikanischer
Sprachen. Ältere und neuere Grammatiken afrikanischer Sprachen
werden einer kritischen Würdigung unterzogen. Lit.: T. Givon,
Syntax, Vol. I und II, Amsterdam/Philadelphia 1984; P.H.
Matthews, Morphology, Cambridge 1987.
P Struktur des Ewe (GS/HS)
Storch, Anne
Do 10-12 (Vb 13.4.)
Das Ewe gehört zu den Kwa-Sprachen und damit zum Niger-Congo-Phylum. Innerhalb des Kwa bilden die sog. Ewe- oder Gbe-Sprachen
ein Dialektkontinuum, zu dem unter anderem das Vhe (Ewe im
engeren Sinne), G1e, Aja, F1o und G1u zählen. Das Verbreitungsgebiet reicht vom Südosten Nigerias über Benin und Süd-Togo bis
nach Südost-Ghana, die Sprecherzahl wird auf 2-4 Mio. Muttersprachensprecher geschätzt. Im Kurs werden insbesondere das
Nominal-, Pronominal- und Verbalsystem dieser wichtigen westafrikanischen Verkehrssprache behandelt sowie in ihre syntaktischen Grundstrukturen eingeführt. Ein qualifizierter Schein
kann durch die Teilnahme an einer Abschlußklausur erworben
werden.
Literatur: H. Pasch: Kurzgrammatik des Ewe, Köln 1995. - T.
Schadeberg: A Small Sketch of Ewe, AAP Sondernummer 1985. - D.
Westermann: Grammatik der Ewe-Sprache, Berlin 1907.
PProbleme der sprachhistorischen Rekonstruktion in Afrika
(GS/HS)
Voßen, Rainer
Mo 16-18 (Vb 10.4.)
Die Rekonstruktion sprachhistorischer Prozesse hat seit dem Ende
des II. Weltkriegs breiten Raum innerhalb der afrikanischen
Forschung eingenommen und zu einer Vielzahl nicht nur interessanter Ergebnisse, sondern auch situationsspezifischer Probleme
geführt, deren Erörterung Ziel dieser Veranstaltung ist.
Teilnahmevoraussetzung sind nachgewiesene Vorkenntnisse im
Bereich der historischen Linguistik und die Bereitschaft zur
Übernahme eines Kurzreferates.
P Struktur des Kanuri (GS/HS)
Löhr, Doris
Mi 14-16 (Vb 12.4.)
Die Kanuri-Sprache wird von ca. 4-5 Mill. SprecherInnen rund um
den Tschadsee gesprochen, vor allem aber in Nordost-Nigeria. Der
Kurs soll in die Grundlagen dieser saharanischen Sprache
einführen. Als Lehrbuch dient N. Cyffer, We learn Kanuri, Köln
1991.
P Migrationsbewegungen im Spiegel der Sprache (GS/HS)
Leger, Rudolf
Mo 10-12 (Vb 10.4.)
Völkermigrationen werden fast immer von Begegnungen mit anderen
Populationen und Kulturen begleitet. Diese Kontakte führen je
nach Dauer und Intensität zum Austausch von wirtschaftlichem,
sozialem oder gedanklichem Kulturgut. Welche Spuren sich bei
diesen Migrationsprozessen mit Hilfe linguistischer Methoden
feststellen bzw. nachvollziehen lassen, wird Thema dieser
Veranstaltung sein. Der Schwerpunkt hierbei wird bei den im
“Mega-Tschad” ansässigen Völkern liegen.
S Sprachkontakt in Afrika (GS/HS)
Voßen, Rainer
Do 14-16 (Vb 13.4.)
Sprachkontakt stellt eine der Hauptursachen von Sprachwandel und
damit sprachgeschichtlicher Entwicklung dar. Sprachkontaktforschung (SKF) erfordert die Untersuchung aller konvergenten
Erscheinungsformen und der ihnen zugrundeliegenden Konvergenzprozesse innerhalb eines gegebenen Untersuchungsareals. Als
konvergente Erscheinungsformen kommen grundsätzlich zunächst all
jene sprachlichen Phänomene in Betracht, die sich nicht als
Ergebnis divergenter Entwicklungsprozesse (genealogische
Herleitung) nachweisen lassen. Da davon ausgegangen werden kann,
daß keine Sprache in völliger Isolation von anderen Sprachen
existierte bzw. existiert, ist sprachhistorische Forschung ohne
SKF unvollständig. Die Veranstaltung will Hypothesen und Modelle
der modernen SKF im Lichte der Theoriebildung vorstellen und an
konkreten Beispielen illustrieren. Teilnahmebedingung ist die
Übernahme eines Referates.
Literatur: (1) S.G. Thomason & T. Kaufman, Language Contact,
Creolization and Genetic Linguistics, Berkeley 1988.- (2) S.G.
Thomason (Hrsg.), Contact Languages: A Wider Perspective,
Amsterdam & Philadelphia 1997.
V Länderkunde des westlichen Afrika (GS/HS)
Leger, Rudolf
Mo 14-16 (Vb 10.4.)
Diese Veranstaltung ist eine generelle Einführung in die
räumlichen, demografischen, gesellschaftlichen, politischen und
sprachlichen Verhältnisse des westlichen Afrika. Die Schwerpunkte
der Vorlesung liegen auf den Ländern Nigeria, Kamerun und Tschad.
POralität und Ritualität als dominante Eigenschaften der
traditionellen Kultur in Afrika (GS/HS)
Beilis, Victor
2 stdg. (Vb n. V.)
Der Kurs ist die Fortsetzung von “Oralität und die Wortkunst in
Afrika”. Es geht um die Kommunikationssysteme in der schriftlosen
Kultur.
ÜDie afrikasprachlichen Literaturen im Kontext der Weltliteratur (GS/HS)
Geider, Thomas
2 stdg. (Vb n. V.)
Das von Goethe ins Leben gerufene Konzept der Weltliteratur
impliziert sowohl einen weltweit gültigen Kanon von bedeutenden
Werken der Schriftliteratur als auch eine bewußte Praxis der
wissenschaftlichen und öffentlichen Kommunikation über fremde
Literaturen, die in den letzten Jahren durch die kulturelle
Globalisierung wieder in die Diskussion kommt. Noch ungeklärt
ist, wie die Oralliteraturen und neu entstehenden afrikasprachlichen Schriftliteraturen in dieses Konzept zu integrieren sind.
Die Komparatistik ist auf die Kooperation mit den Einzelphilologien aller Sprachen angewiesen. Die Afrikanistik sollte hier zu
ihrem eigenen Vorteil nicht zurückstehen. Die Übung thematisiert
die neuere Diskussion des Weltliteraturkonzepts, den bisherigen
afrikanistischen Umgang damit, die nötigen interdisziplinären
Konzepte und eine Reihe von Werken und Texten der afrikanischen
Literaturen. Teilnehmer anderer Philologien sind ausdrücklich
eingeladen.
Die Übung wird als Kompaktseminar abgehalten. Erste Planungsschritte sollen unmittelbar nach der Semestervorbesprechung des
Instituts am Montag, den 3. April 2000 diskutiert werden.
Außerdem bin ich leicht per Telefon erreichbar: Dr. Thomas
Geider, Tel.: 0221/ 24 29 77.
Literatur zur Vorbereitung für alle TeilnehmerInnen:
Koppen, Erwin. 1984. ‘Weltliteratur̓. In: Klaus Kanzog & Achim
Masser (Hrsg.), Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte,
Band 4. Berlin / New York: Walter de Gruyter. Pp. 815-827.
K Fulfulde III (HS)
Leger, Rudolf
Di 16-18 (Vb 11.4.)
Weiterführung des im SS 1999 begonnenen Sprachkurses Fulfulde I,
dem das Lehrbuch H. Jungraithmayr & Abu-Manga (1989), Einführung
in die Ful-Sprache, Berlin zugrunde liegt.
S Vergleichende Nominalmorphologie der Bantusprachen (HS)
Voßen, Rainer
Di 14-16 (Vb 11.4.)
Die Untersuchung nominalmorphologischer Elemente und Prozesse ist
so alt wie die Tradition der Bantuistik als Teilgebiet der
Afrikanischen Sprachwissenschaften. Im Mittelpunkt des Interesses
stehen das präfixorientierte Nominalklassensystem mit den von ihm
ausgelösten Konkordanzmechanismen sowie die suffixorientierten
Derivationsstrategien. Daneben wird den durch Pidginisierung/Kreolisierung ausgelösten strukturalen Veränderungen am Nomen
besondere Beachtung zuteil. Die Veranstaltung zielt auf einen
systematischen Überblick ab.
S Semantische Verbklassen in afrikanischen Sprachen (HS)
Voßen, Rainer
Di 10-12 (Vb 11.4.)
Im Kontext afrikanischer Sprachen erscheint die Diskussion von
Verbklassen auffällig einseitig auf strukturale, d.h. morphologische und/oder tonale Einteilungskriterien begrenzt. Auch
das Lexikon der Afrikanistik (Berlin 1983, S.259) macht hier
keine Ausnahme, verweist es doch allein auf segmentale und
suprasegmentale Unterscheidungsmerkmale. Nur wenige neuere
Arbeiten haben die Bedeutung der Semantik für die Definition des
Verbklassenbegriffs herausgestellt und thematisiert. Dem soll in
dieser Veranstaltung weiter nachgegangen werden.
KO Magistranden- und Doktorandenkolloquium (HS)
Voßen, Rainer
Do 12-13 (14.4.)
MagistrandInnen und DoktorandInnen stellen Stand und Fortschritt
ihrer Arbeit in Form von Referaten vor. Dabei sollen durch
Anregungen, Kritik und Diskussion Fortgang und innere Entwicklung
der laufenden Arbeiten gefördert werden.
KO Colloquium Linguisticum Africanum (HS)
Gem.-Veranst.
Fr 11.30-13 (Vb n.V.)
GastreferentInnen und MitarbeiterInnen des Instituts tragen
neuere Ergebnisse aus laufenden Forschungsarbeiten vor.
Orientalistik
Auskunft: Dantestr. 4-6/V, Zi. 505, Ruf 798-22855. Individuelle
Stud.-Beratung vor Beginn der Veranstaltungen (für Erstsemester
unerläßlich!).
Vorbesprechung: Mi 5.4., 14 Uhr c.t., Dantestraße 4-6.
ÜEinführung in die arab. Philologie II
Schein: Nach regelmäßiger Teilnahme und Vorbereitung sowie dem
Bestehen der Abschlußklausur wird ein Sprachkursschein ausgestellt.
KEinführung in das Syrisch-Aramäische
Sinologie
Studienberatung: Di 14-16 Uhr und n.V. (Tel.: 069/798-22852),
Dantestr. 4-6, Zi. 604
Semestereinführung: Mo 3.4.2000, 12 c.t.Uhr, Dantestr. 4-6, Raum
309
GRUNDSTUDIUM
K Klassisches Chinesisch II
Kutschka, Sabine
Ort: Raum 309 Zeit: Mo Mi 12.30s.t.-14 (Vb. 05.04.)
Die in Kurs I vermittelten Grundregeln der klassischen chinesischen Schriftsprache wie Wortstellung im einfachen Satz,
Wortbildung, Subordination, Gebrauch von Modal- und Koverben,
Prä- und Postpositionen, Verwendung von temporalen, aspektuellen,
nominalisierenden und anderen Partikeln, sind obligatorische
Grundlage für das Verständnis der Satzstruktur des klassischen
Chinesisch. Diese vorausgesetzt, werden in Kurs II im wesentlichen dieselben Regeln verwendet, aber unter Berücksichtigung
längerer Sätze, zusammenhängenderer Texte, komplizierterer
Satztypen und Kontexte. Das bedeutet zusätzlich die Behandlung
von Nebensatzstrukturen, Ellipsen und eine Erweiterung der
Anwendungsbereiche von Partikeln. Das Lehrbuch von Shadick (s.u.)
bietet hierzu eine attraktive Grundlage, insbesondere weil die
ausgewählten Textbeispiele ein breites Spektrum aus Werken der
klassischen Literatur umfassen und somit gleichzeitig einen
Einstieg in diese ermöglichen.
Die Veranstaltung, deren Vor- und Nachbereitungszeit mit ca. 12
Wochenstunden angesetzt werden muss, wird mit einer zweistündigen
Klausur abgeschlossen.
Literatur: Shadick, H., A First Course in Literary Chinese, 3
Bde. Ithaca, London 1968 (als Lehr- und Arbeitsbuch); ergänzende
Literatur: Pulleyblank, E.G.: Outline of Classical Chinese
Grammar, Vancouver 1995; Vochala, J. u. Vochalavá, R., Einführung
in die Grammatik des Klassischen Chinesisch, Leipzig 1988;
Norman, H., Chinese, Cambridge 1988; Boltz, W.G., The Origin and
Early Development of the Chinese Writing System, New Haven 1994
K Modernes Chinesisch II
Li, Ping
Ort: Raum 309 (Mo), Erdg. 2 (Mi), NM 126 (Do)
Zeit: Mo Mi Do 14-16 (Vb 03.04.)
Diese Lehrveranstaltung ist in erster Linie für Haupt- und
Nebenfachstudierende der Sinologie gedacht, steht aber auch allen
Hörern/Hörerinnen offen, die sich für die moderne chinesische
Sprache interessieren. Die Teilnehmer des Kurses sollen über
Grundkenntnisse der chinesischen Sprache verfügen (z.B. Beherrschung eines Grundwortschatzes von etwa 300 Schriftzeichen und
500 Begriffen oder die Lektionen 1-25 des Lehrbuches Grundstudium
Chinesisch von Chiao Wei et al. Natürlich wird eine andere
gleichwertige Leistung auch anerkannt).Der Schwerpunkt des Kurses
liegt auf integrierten Übungen von aktivem Sprechen und Schreiben
sowie Schulung des Hör- und Leseverständnisses. Die Veranstaltung
dient weiterhin dem Erwerb eines Grundwortschatzes von 600
Schriftzeichen und 1000 Begriffen. Grammatik wird anhand von
Texten erklärt und durch Übungen vertieft.
Leistungsnachweis: drei Diktate während des Semesters und eine
zweistündige Klausur am Ende des Semesters.
Literatur: (zur Anschaffung) Chiao Wei, Annette Sabban und Zhang
Yu Shu, Grundstudium Chinesisch II, Bonn: Verlag Dürr & Kessler,
1992. Das Lehrbuch soll bis zum Semesterbeginn von den Kursteilnehmern selbst besorgt werden.
Ü Modernes Chinesisch IV
Li, Ping
Ort: NM 126 Zeit: Mo Mi 10.30s.t.-12 (Vb 05.04.)
Diese Lehrveranstaltung ist in erster Linie für Haupt- und
Nebenfachstudierende der Sinologie gedacht, steht aber auch allen
Hörern/Hörerinnen offen, die sich für die moderne chinesische
Sprache interessieren. Die Teilnehmer des Kurses sollen über
Grundkenntnisse der chinesischen Sprache verfügen (z.B. Beherrschung eines Grundwortschatzes von etwa 900 Schriftzeichen und
1400 Begriffen oder des Lehrbuchs Grundstudium Chinesisch I und
II von Chiao Wei et al. Natürlich wird eine andere gleichwertige
Leistung auch anerkannt). Diese Lehrveranstaltung ist als der
letzte Teil des auf vier Semester ausgelegten Umgangssprachkurses
konzipiert und zielt darauf, die Kenntnisse der chinesischen
Sprache, die die Teilnehmer in den vergangenen Semestern erworben
haben, zu konsolidieren, erweitern und vertiefen. Geübt wird
aktives Sprechen, aber nicht nur in Form der freien Konversation,
sondern auch in Form der thematischen Diskussion, Hörverständnis
von vorgetragenen Fachtexten, Leseverständnis von Fachtexten und
der Schreibstil. Parallel zu den Kurzzeichen lernen die Teilnehmer auch die Langzeichen. Zur grammatischen Übung wird das
Lehrbuch Grundstudium Chinesisch II benutzt. Leistungsnachweis:
zweistündige Klausur am Ende des Semesters.
Ü Grundzüge der chinesischen Geschichte
Li, Ping
Ort: Erdg. 2 Zeit: Do 11-13 (Vb 06.04.)
Wie der Name schon sagt, dient die Lehrveranstaltung dem Erwerb
von Grundkenntnissen in der chinesischen Geschichte. Nach einer
chronologischen Einführung, die etwa sechs Sitzungen einnimmt,
werden bestimmte Zeitperioden und wichtige historische Ereignisse
behandelt, indem die Teilnehmer über verschiedene Themen
referieren und diskutieren. Die vorgeschlagenen Themen sind unter
anderem: 1. Die kulturellen Errungenschaften während der Zhou-Zeit (West-Zhou, Ost-Zhou: Frühling-Herbst, Streitende Reiche),
2. Der erste Kaiser von China und der vereinte Staat, 3. Die
wirtschaftliche Entwicklung unter der Han-Dynastie und die
Erschließung der Seidenstraßen, 4. Die Herrschaft der Xianbei in
Nordchina, 5. Der Aufschwung und die Expansion Chinas unter der
Tang-Dynastie, 6. Von den Krisen der Song-Dynastie bis zur
Herrschaft der Mongolen in China, 7. Die wirtschaftliche und
technologische Entwicklung unter der Ming-Dynastie, 8. Die
Errichtung der Mandschu-Herrschaft in China; Die letzte Dynastie
Chinas, 9. China und die Kolonialherrschaft, 10. Die chinesische
Republik, 11. Geschichte der Beziehungen zwischen China und dem
Westen. Selbstverständlich dürfen die Teilnehmer auch eigene
Themen zur Diskussion vorbringen.
Leistungsnachweis. Die regelmäßige Teilnahme und ein Referat
Literatur: The Cambridge History of China; Eberhard, Wolfram,
Geschichte Chinas: Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Stuttgart
1971; Granet, Marcel, Die chinesische Zivilisation, Frankfurt
1985; Gernet, Jacques, Die chinesische Welt, Frankfurt 1979;
Schmidt-Glintzer, Helwig, China, Vielvölkerreich und Einheitsstaat von den Anfängen bis heute, München 1997; China, eine Wiege
der Weltkultur, 5000 Jahre Erfindungen und Enteckungen, Mainz
1994; Grießler, Margarete, China, Alles unter dem Himmel, eine
Reise durch 5000 Jahre Kultur und Geschichte, Darmstadt 1996.
P Konfuzianische Klassiker II
Kutschka, Sabine
Ort: Erdg. 2 Zeit: Fr 10-12 (Vb 07.04.)
Schwerpunkt dieses Proseminars ist die Lektüre, Übersetzung und
Interpretation ausgewählter Originalpassagen aus den konfuzianischen Klassikern (insb. Lunyu, Mengzi). Eine eingehende Analyse
der Texte leitet zu semantisch präzisem Übersetzen hin. Sie wird
ergänzt durch eine Darstellung des geistesgeschichtlichen Umfelds
und der philosophischen Bedeutung der ältesten konfuzianischen
Texte, sowie dem Vergleich mit nicht-konfuzianischen und
außerchinesischen Philosophietraditionen. Grundlage des Scheinerwerbs sind die regelmäßige Teilnahme und die Anfertigung
eigenständiger Übersetzungen einzelner Textpassagen.
Literatur: (Textausgaben) Xu Bochao ed., Sishu duben, Taibei 4.
Aufl. 1980; Liu Baonan ed., Lunyu zhengyi, in: Zhuzi Jicheng,
vol. 1, H.K. 1978; (grundlegend) T. Chang, Chines. Moralphilosophen gestern und heute, in: 60. Schopenhauer-Jb., Frankfurt/M
1979; O. Franke, Der geschichtliche Konfuzius, ZDMG 1925; H.
Roetz, Konfuzius, München 1995; (weiterführend) H.G. Creel,
Confucius and the Chinese Way, N.Y. 1949; H. Fingarette,
Confucius, the Secular as Sacred, N.Y. 1972; W. Schluchter ed.,
Max Webers Studie über Konfuzianismus und Taoismus, Frankfurt/M
1983; D.L. Hall & R.T. Ames, Thingking through Confucius, Albany
1987; H. Roetz, Die chinesische Ethik der Achsenzeit, Frankfurt/M
1992.
S Grundriss der altchinesischen Grammatik
Simon, Rainald
Ort: Raum 309 Zeit: Mo 9-11 (Vb 03..04.)
Im Mittelpunkt stehen rezente neuchinesische Grammatiken des
klassischen Chinesischen, die ausnahmslos für den Anwender
gedacht sind. Wir stellen aus diesen Texten Grundzüge zusammen.
Dabei gehen wir von den angebotenen Beispielsätzen aus der
klassischen Literatur aus und versuchen zunächst, eigene
Erklärungen der grammatischen Struktur zu finden.
Das Ziel des Seminares ist es, vorhandene Kenntnisse zu wiederholen, unter Umständen zu erweitern und systematisierend zusammenzufassen. Der Zweck ist immer die zukünftige Rezeption klassischer chinesischer Texte, nicht die Grammatik als Gegenstand
wissenschaftlicher Arbeit.
Das Seminar ist für alle Studierenden offen, die bereits
Vorkenntnisse im klassischen Chinesischen (Haenisch/Shadick)
erworben haben. Voraussetzung für den Erwerb eines Scheines ist
die erfolgreiche Teilnahme an der Klausur am Semesterende, in der
die Kenntnis des Semesterstoffes nachgewiesen werden soll. In der
zweiten Hälfte des Semesters wird ein Reader erhältlich sein, der
den zu lernenden Stoff enthält.
Literatur: Ma Hanlin, Abriß der Grammatik des klassischen
Chinesischen, Gu Hanyu yufa tiyao, Xian 1985; Autorengremium der
Chinesisch-Abteilung der Pädagogischen Hochschule Nanjing, Gu
Hanyu jichu zhishi, Jiangsu 1976; Autorengremium der Chinesisch-Abteilung der Pädagogischen Hochschule Beijing, Wenyan yufa
changshi, Beijing 1975; Lü Shuxiang, Grammatische Funktionswörter
des Klassischen Chinesischen, Wenyan xuzi, Shanghai (1958),
19782; Zhao Guangcheng, Mustererklärungen zu grammatischen
Funktionswörtern des Klassischen Chinesischen, Wenyan xuzi lijie,
Jinan 1978
HAUPTSTUDIUM
Ü Modernes Chinesisch: Konversation
Li, Ping
Ort: Erdg. 1 Zeit: Di 14-15 (Vb 05.04.)
Die Lehrveranstaltung ist für alle gedacht, die Chinesisch aktiv
sprechen wollen und sich auch schon auf mittlerem Niveau mündlich
ausdrücken können. Die Veranstaltung wird besonders denjenigen
Studierenden empfohlen, die vorhaben, in der nächsten Zeit nach
China zu gehen, um ihre Sprachkenntnisse zu verbessern oder dort
eine Zeitlang zu studieren. So dient sie auch als ein Vorbereitungskurs. Angesprochen werden hier nicht nur verschiedene
Themen, die auf das alltägliche Leben in China bezogen sind,
sondern auch politische und wirtschaftliche Inhalte.
Leistungsnachweis: aktive Teilnahme
Ü Chinesische Gegenwartsliteratur
Li, Ping
Ort: Erdg. 2 Zeit: Di 12-13 (Vb 04.04)
Die Lehrveranstaltung bietet einen Überblick über die wichtigsten
Weerke chinesischer Autoren des 20. Jahrhunderts. Leben und Werk
des jeweiligen Autors sollen in Form von Kurzreferaten vorgestellt werden. Bei der Lektüre geht es zuerst darum, die
ausgewählten Texte sprachlich richtig zu verstehen; dann wird
über den Inhalt und Stil diskutiert. Folgende Autoren und ihre
Werke werden behandelt: Xiao Hong, Chen Baichen, Ai Qing, Zang
Kejia, He Qifang.
Kopien der ausgewählten Texte werden den Teilnehmern zur
Verfügung gestellt.
Leistungsnachweis: aktive Teilnahme
Ü Modernes Chinesisch: Lektüre chinesischer juristischer Texte
Li, Ping
Ort: Erdg. 1 Zeit: Di 15-16 (Vb 04.04.)
Das Ziel der Lektüre ist, die Teilnehmer mit den chinesischen
juristischen Texten vertraut zu machen und sie zur Auseinandersetzung mit dem chinesischen Rechtssystem anzuregen. Während
der Lektüre sollen sich die Teilnehmer ebenfalls mit den Fragen
befassen: Was für ein Staat ist China? Wie groß ist die Diskrepanz zwischen der juristischen Definition und der Realität und
Praxis des chinesischen Staates? Gelesen werden die chinesische
Verfassung und andere wichtige Gesetze.
Leistungsnachweis: aktive Teilnahme
Ü Wirtschaftschinesisch II
Li, Ping
Ort: Erdg. 2 Zeit: Di 11-12 (Vb 04.04.)
Diese Lehrveranstaltung ist sowohl für Haupt- und Nebenfach
studenten/-innen der Sinologie als auch für die Hörer/Hörerinnen
anderer Fachbereiche gedacht, die sich für die chinesische
Wirtschaftssprache interessieren. Die Lehrveranstaltung bietet
eine Einführung in die chinesische Wirtschaftssprache und -terminologie, z.B. der Geschäftsverhandlungen, der Verträge, der
Bestimmungen usw. Sie bietet auch eine Einführung in die
politischen, geschichtlichen und soziokulturellen Besonderheiten
der chinesischen Wirtschaft und des Außenhandels. Die Teilnehmer
sollen über Grundkenntnisse der chinesischen Sprache (z.B.
erfolgreiche Teilnahme der Sprachkurse I-II) verfügen,
Leistungsnachweis: regelmäßige Teilnahme
Literatur: Zhang Jingxian, Hanyu Waimao Konyu, Beijing 1991,
ISBN: 7-5619-0117-8/H.85 (zur Anschaffung); Goh, Bee Chen,
Negotiating with the Chinese, Aldershot, 1996.
S Philologisches Oberseminar für Magistranden
Chang, Tsung-tung
2std. nach persönlicher Anmeldung
KO Doktorandenkolloquium
Chang, Tsung-tung
2std. nach persönlicher Anmeldung